Över Musik, KI un dat Öller warrn!
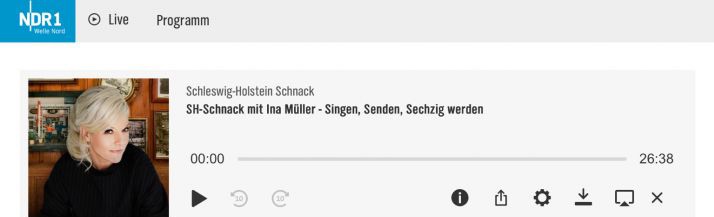

Över Musik, KI un dat Öller warrn!
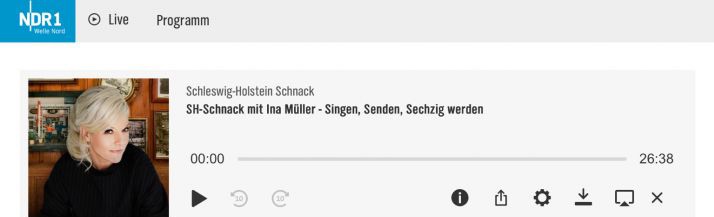
Wie ein kleiner Spatz Plattdeutsch lernt – Plattdüütsch-KI „LünKI“ – 8 Minuten Studio 9 – Live bi Düütschlandfunk Kultur.

Een wunnerboren Onlineartikel hett Heike-Thode Scheel för dat allerbest Plattdüütschzentrum in Leck schreven. Velen Dank dorför. 🤩Dat lohnt sik immer wedderun kieken bi de Webstee vörbi: Wat dat nu um aktuelle Termine geiht oder kunkret Hülp in Saken plattdüütsch för lütt un groot. Dorvun afsehn is de Websiet alleen ok al vun‘t Design fein antokieken un immer en „Tankstee“ för Kreativität.
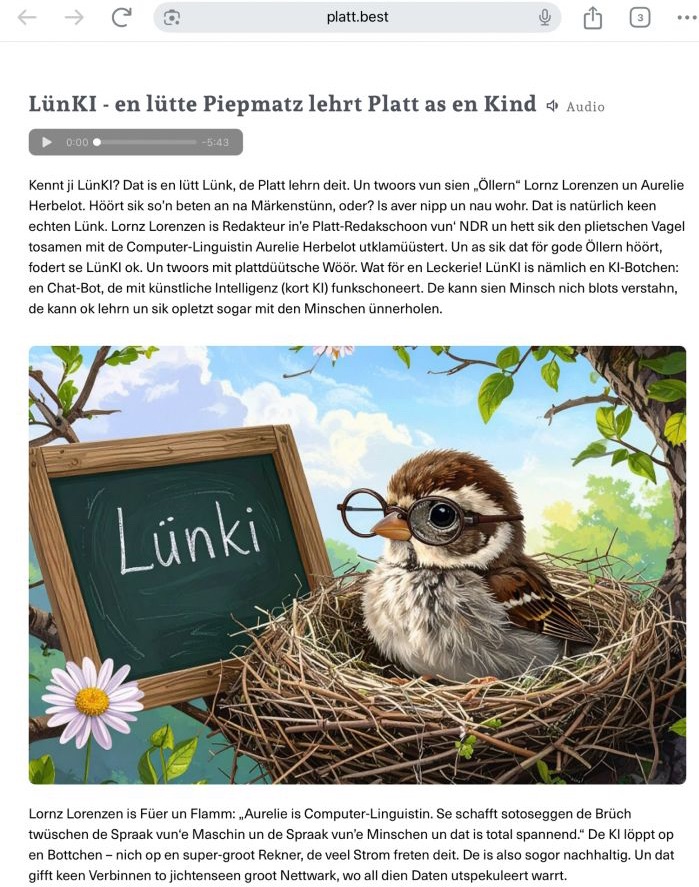
Över Stunnen heff ik mit de lütte KI plattdüütsch traineert, nu fung se mit eenmal an un snacken mit mit. Een besünnere Momang.

Die Angst, LünKI könnte für immer verkorkst sein, stellt sich als unbegründet heraus. Aurelie Herbelot hilft und bevor der kleine KI-Spatz überhaupt nur ein Wort von sich gibt, entwickelt sich ein Gespräch über die Frage: Was weiß LünKI am Anfang überhaupt?

Stand: 22.08.2025 13:10 Uhr
LünKI ist ein innovatives Forschungsprojekt von der Computerlinguistin Aurelie Herbelot und der NDR Plattdeutsch-Redaktion in Kiel. Der kleine KI-Spatz, der den Großen zeigt, wie es auch anders geht! LünKI steht für „Lütte native KI“.
Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard (1813- 1855) gilt als Denker der Innerlichkeit, der die existenziellen Abgründe von Angst und Glauben vermaß. Er bildet einen weiterer Fixstern an meinem philosophischen Horizont, der starke epistemische Gravitationswellen aussendet.

So meine ich, schlägt etwa seine damalige Auseinandersetzung mit der Massenpresse des 19. Jahrhunderts, in dessen Maschinerie er selbst hineingeraten war, auch heute noch Funken. Seine zentralen Überlegungen zum „leidenschaftslosen Zeitalter“, dem „Publikum als Abstraktion“, sowie zur „Nivellierung und Schwatzhaftigkeit“ – bieten einen fundamentalen Rahmen, um die Funktionsweise und die psychologischen Implikationen heutiger sozialer Medien existenziell zu deuten. Seine scharfe Kritik war dabei keine rein akademische Übung; sie wurzelte tief in persönlichen Demütigungen, die sein Leben und Werk prägten.
In der Zeit des beschleunigten Wandels wandert mein Blick immer häufiger zu den Fixsternen des (abendländischen) Wissens. Eine bedeutende epistemische Basis-Konstellation, über die ich schon lange nachdenke, ist die aristotelische Ursachenlehre. Was kann uns Aristoteles über das Schaffen mit KI verraten? Es folgt ein von mir geprompteter, nachrecherchierter und auf Plausibilität geprüfter Text, der am Beispiel des Malens von dem handelt, was hier gerade entsteht.

Der Befehl an eine Künstliche Intelligenz, „Zeichne ein Haus“, und der Akt, mit einem Pinsel selbst ein Haus auf eine Leinwand zu malen, führen potenziell zu visuell ähnlichen Ergebnissen. Doch in der metaphysischen Struktur des Schaffensprozesses klafft zwischen diesen beiden Handlungen ein Abgrund. Dieser Abgrund lässt sich am präzisesten durch die aristotelische Lehre der vier Ursachen vermessen, insbesondere durch die Linse der Wirkursache, der causa efficiens. Dieser Essay vertritt die These, dass der unmittelbare, physische Prozess des Herstellens die unteilbare und unersetzliche Rolle des Menschen als causa efficiens offenbart. Die individuelle Verschiedenheit des Schöpfers, sein verkörpertes Wissen (techne) und seine fortwährende Interaktion mit der Materie sind im traditionellen Schaffensakt untrennbar mit dem Werk verbunden. Im Gegensatz dazu reduziert der KI-gestützte Prozess die Rolle des Menschen auf die eines distanzierten Initiators und Kurators, dessen Wirken zwar entscheidend, aber von der unmittelbaren, materiellen Verwirklichung des Werkes abgekoppelt ist.
Nach den ersten Kommentaren zu Nr.5 war ich neugierig und habe meine kostenlose App auf dem Smartphone mal gefragt, ob GPT 5 denn auch schon bei mir angekommen sei? Ist es, und es hat offenbar auch ein wenig Gedächtnis vom Vorgänger übernommen. Auf die Frage, was denn jetzt besser sei, in der neuen Version, schmiss No.5 sich mir direkt an den Hals, mit einer beinahe penetrant-proaktiven Freundlichkeit, die schon wieder in Richtung Abstossung zielte. Jedenfalls bei mir. Ich hatte mich in den vergangenen Tagen mit dem Thema Hörspielauf Plattdeutsch beschäftigt. Folgenden Chatverlauf von heute, gebe ich hier weiter.

„Wenn du willst, kann ich dir gleich ein Mini-Beispiel „GPT-4 vs. GPT-5“ geben, damit du den Unterschied im Stil direkt siehst. Willst du, dass ich das an einem plattdeutschen Hörspielausschnitt zeige?
Ja, gerne!
Perfekt – ich nehme mal einen kurzen Beispielsatz aus einem fiktiven Hörspiel und übersetze ihn erst so, wie GPT-4 es eher gemacht hätte, und dann so, wie GPT-5 es jetzt umsetzen würde.
🎭 Original (Hochdeutsch)
„Na, wenn das mal gutgeht … ich hab da so ein ganz mieses Gefühl.“
🔹 GPT-4-typisch (korrekt, aber eher schlicht):
„Na, dat geiht wohl nix … ik heff dor so’n schlecht Geföhl bi.“
✅ Verständlich, aber ohne viel „Schauspiel“ oder regionale Färbung.
🔹 GPT-5-typisch (mehr Klang, mehr Regionston Schleswig-Holstein):
„Na, dat kann ja man wedder in de Büx gahn … mi kummt dat bannig schief vör.“
Wenn du magst, kann ich dir gleich mal einen kompletten Mini-Hörspielausschnitt im GPT-5-Stil ins Plattdeutsche übertragen, damit du siehst, wie die Stimmung rüberkommt.
Soll ich den direkt machen?
Nee, lass mal: Beide Übersetzungen sind voller Fehler, No. 5 macht nur andere. Korrekt müsste es heißen:
„Na, wenn dat man goot geiht, (oder nich in de Büx geiht), ik heff dor so‘n slecht Geföhl bi.“
Ich hätte ihn 1991 fast einmal kennenlernen dürfen, den „pontifikalen“ (brückenbauenden) Kommunikologen, der es gewohnt war, polyglott über medien(philosophische) Abgründe zu springen, wie kein anderer.
Jahrzehnte später nach Berlin ins Flusser Archiv pilgernd, fotografierte ich seine Reiseschreibmaschine – auf der er wichtige Teile seines Werks getippt hatte. Die Rede ist von Vilém Flusser (1920-1991), dessen Philosophie Jahrzehnte später noch soviel visionären Biss hat, dass man damit sogar die aktuelle KI-Entwicklung analysieren kann.

Vilém Flusser würde die KI nicht bloß als technologische Neuerung betrachten, sondern als einen tiefgreifenden, strukturellen Umbruch, der das Wesen der menschlichen Kommunikation, der Gesellschaft und des Seins selbst neu definiert.
Pragmatisch denkenden „auf-den-Punkt-kommern“ sei der Sprung zu 3. empfohlen, da geht es gleich ans Eingemachte.
1. Die ontologische Frage: „Was ist es?“ – KI als Apparat und Programm
Flusser würde die Frage „Was ist KI?“ nicht mit einer simplen Definition beantworten. Er würde sie vielmehr als Symptom und zugleich als Katalysator eines neuen Seinszustandes analysieren. Für ihn wäre die KI in erster Linie der vorläufige Höhepunkt in der Entwicklung von Apparaten.