Transparenzhinweis: Dieser KI-Essay ist mithilfe von Google Gemini 2.5 „Deep Research“ gepromptet und von mir händisch überarbeitet worden. Ausgangspunkt war diese Anweisung: „Bitte erarbeite einen Essay der eine Brücke schlägt zwischen Sören Kierkegaards zeitgenössischer Kritik an den Zeitungen damals und den sozialen Medien heute. Wie würde Kierkegaard die heutigen Medien kritisieren und was würde er fordern?“. Es sollte niemanden überraschen, dass Kierkegaards Medienkritik eher konservativ ausfällt und emanzipatorische Entwicklungen in Geminis „Reasoning“ vernachlässigt werden. Siehe beispielsweis Flussers kommunikologischen Ansatz in meinem Blogbeitrag vom 24. Juli. Ebenfalls beinhaltet der Prompt ja bereits die erst zu hinterfragende Annahme, das Presse und Socialmedia so überhaupt miteinander verglichen werden könnten.
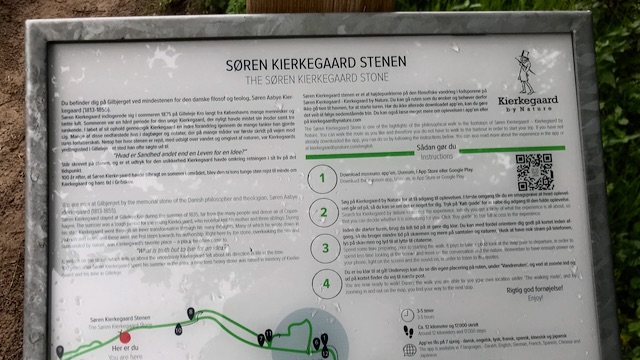
Die Signatur des Zeitalters: Reflexion ohne Leidenschaft
Den Ausgangspunkt für Kierkegaards Kulturkritik bildet die Diagnose eines „leidenschaftslosen und reflektierten Zeitalters“. Er charakterisiert seine Epoche als eine, die von einer lähmenden, distanzierten Analyse und einem Mangel an handlungsleitender Überzeugung gezeichnet ist. An die Stelle entschlossener Taten treten, so Kierkegaard, flüchtige Begeisterungsstürme, die nicht selten in Untätigkeit zurückfallen“.
Dieses Phänomen manifestiert sich heute im sogenannten „Slacktivismus“. Oberflächliches Engagement wie das Liken oder Teilen erzeugt die Illusion politischer Teilhabe, ohne die riskante, persönlich verbindliche Tat zu erfordern, die für Kierkegaard allein zählt. Die permanente Reflexion innerhalb digitaler Echokammern hemmt die Handlung, bis die ursprüngliche Leidenschaft erlischt. Das existenzielle Wagnis, das Kierkegaard im Gleichnis des mutigen Schlittschuhläufers beschreibt, wird in einer solchen Kultur nicht mehr bewundert, sondern als unvernünftig abgetan.
Die persönliche Wurzel der Kritik
Kierkegaards tiefe Skepsis gegenüber der öffentlichen Meinung war keine bloße Theorie; sie wurde durch leidvolle Erfahrungen mit der Presse geformt. Ende 1845 geriet Kierkegaard in eine öffentliche Konfrontation mit der einflussreichen satirischen Wochenzeitung „Corsaren“. Nachdem das Blatt ihn gelobt hatte, forderte er es öffentlich auf, ihn stattdessen zu verspotten. Die Redaktion nahm die Herausforderung an und entfesselte eine monatelange, gnadenlose Kampagne, die Kierkegaard zur öffentlichen Spottfigur machte. Die Zeitung veröffentlichte Karikaturen, die ihn als bucklige Gestalt mit ungleich langen Hosenbeinen darstellten. Die Artikel griffen auch die Trennung von seiner Verlobten Regine Ohlsen auf und stellten ihn als verkrüppelten Mann dar, der sie nur ausgenutzt habe. Die Kampagne hatte reale Folgen: Auf seinen täglichen Spaziergängen, die er als „Menschenbad“ zur Inspiration nutzte, wurde er nun auf der Straße verspottet.

Das Publikum als Abstraktion: Der Algorithmus und die verlorene Verantwortung
Diese persönlichen Erfahrungen schärften Kierkegaards Begriff des „Publikums“. Er verstand darunter keine Gemeinschaft, sondern ein anonymes, unverantwortliches Phantom – eine „monströse Abstraktion“, die durch die Medien geschaffen wird. Die verheerende Folge ist die Auflösung der persönlichen Verantwortung, da dasPublikum als „Niemand“ nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann.
